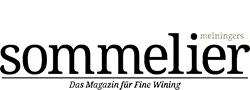Eigentlich esse ich gar keine Lebkuchen,“ sagt die geschätzte Kollegin neben mir mit vollen Backen. „Warum sagst Du das?“ möchte ich wissen, als sie in die Tüte greift, um sich einen Zweiten zu gönnen. Der stete Zwang der Menschen, sich im Jargon der Eigentlichkeit selbst zu widerlegen, ist erstaunlich. Das Muster ist stets dasselbe: Während man eine bestimmte Handlung ausführt, erzählt man dabei, dass man dieses oder jenes für gewöhnlich gar nicht tue. Eigentlich.
Das „Eigentlich“ hält, was das „ja, aber…“ verspricht. Es ist das ‚two in one‘ für Wankelmütige. Was sich liest wie abseitiges sprachwissenschaftliches Gemoser, spiegelt ein gesamtgesellschaftliches Problem: Eine Geisteshaltung mit generell negativem Grundton. Ohne Not und böse Absicht malen wir damit kulinarische Freude mit dickem Edding schwarz, anstatt sie im Glanze der Verzückung strahlen zu lassen. Macht es mich zu einem besseren Menschen, wenn ich meinem Gegenüber erkläre, ich äße für gewöhnlich keine Lebkuchen? Sind Lebkuchen verpönt und vom Vatikan mit drei extra Rosenkränzen belegt? Und warum um Gottes Willen spricht sie darüber? Man kommt eigentlich nur zu dem einen Schluss: Die Frau ist plemplem.
Ein perfider Auswuchs des Eigentlichs ist das doppelt einschränkende Eigentlich. „Eigentlich esse ich gar kein Lamm, aber dieses war vorzüglich.“ Die Aussage wird danach immer ergänzt vom Appendix „denn es schmeckte gar nicht nach Lamm.“ Der hanebüchenen Kasteiung als frevelhafter Sünder mit offensichtlichem Dachschaden folgt die unverfrorene Nivellierung, die dem Gegenstand der Versündigung auch noch seine geschmacklichen Eigenschaften nach Lamm zu schmecken abspricht, und uns nur dadurch aus der misslichen Lage des Büßers befreit. Ernsthaft, jetzt?
Dieses Beispiel ist übertragbar auf praktisch jedes Lebensmittel außer Zwieback: Man äße als weltoffener Bürger natürlich sehr gerne scharf, aber zu scharf sollte es nicht sein. Desserts äße man eigentlich niemals, aber dies war traumhaft, denn es war nicht so süß. Mediterrane Küche sei eigentlich ok, wenn sie nicht zu sehr nach Knoblauch schmecke, und der Fisch, naja, den esse man eigentlich auch nicht, weil der eigentlich immer nach – Überraschung! – Fisch schmecke. Käse sei an und für sich auch etwas Feines, wenn er einem nur nicht immer so auf den Wecker fallen müsse mit seinem unerträglichen Gestank. Das gleiche Spiel lässt sich mit Getränken weiterführen. Niemals käme einem dieser fiese, saure Riesling ins Glas, aber diese Flasche sei ganz vorzüglich. Auch Merlot spiele keine Rolle in der Getränke-Kette, aber wer schlägt schon ein Glas Petrus aus? Es ist ein Fass ohne Boden, und wir haben noch gar nicht von Innereien, Kümmel, Koriander oder Grauburgunder gesprochen.
Geschmack an sich ist also schon okay, soviel können wir festhalten, nur zu stark sollte er nicht sein. Überhaupt sollte Essen keine Extreme beinhalten, sondern leise plätschern wie die Gema-freie Hintergrundmusik im Einkaufscenter. Statt uns zu freuen und diese Freude adäquat wie zivilisierte Menschen auszudrücken, verklausulieren wir jede kulinarische Freude ins Negative. Dabei ist Moll eigentlich die Tonart, die bei Beerdigungen angeschlagen wird. Es ist nicht die Tonalität, in der wir über Essen und Trinken reden sollten. Letztlich sagt es eigentlich nur eins: dass derjenige schlichtweg an Geschmacksarmut leidet.