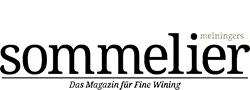Teil I: Von Berührungsängsten, Wasser und Malz.
Als sich der bayerische Brauer Josef Groll im Jahr 1842 auf den Weg von Vilshofen in die böhmische Stadt Pilsen machte, um einen Zweijahresvertrag beim dortigen Bürgerlichen Brauhaus anzutreten, hat der 29-Jährige wohl an vieles gedacht. Nicht aber daran, dass sein Auftrag, ein untergäriges Bier mit hellerem Malz zu brauen und somit das Image des in Verruf geratenen dunklen, obergärigen Bieres der Stadt zu retten, die Bierwelt verändern würde. Das Ergebnis, ein gut gelagertes, goldblondes, gleichermaßen hopfenaromatisches wie malzbetontes Bier, präsentierte er erstmals am 11. November 1842, also vor gut 180 Jahren. Sein Plzeňský Prazdroj, heute weltweit bekannt als Pilsner Urquell, konnte auf Anhieb begeistern, wurde schon bald zum Exportschlager und begründete den Bierstil Pilsner. Das Erfolgsgeheimnis: helles, mild gedarrtes Gerstenmalz aus der tschechischen Provinz Mähren, dazu blumig-aromatischer Saazer Hopfen und – nicht zuletzt – das besonders weiche Wasser aus dem artesischen Brunnen der Brauerei. Mit Ausnahme eines bayerischen untergärigen Hefestammes also ausschließlich tschechische Rohstoffe. Ein Bier mit diesen sensorischen Eigenschaften konnte zu der damaligen Zeit nur an genau diesem Ort gebraut werden. Von Terroir hat damals selbstverständlich dennoch niemand gesprochen – und auch heute noch nimmt kaum ein Brauer das Wort in den Mund.

Einer, der da weniger Berührungsängste hat, ist Michael Zepf, der bei der Doemens Academy den Geschäftsbereich Genussakademie leitet und für die Biersommelier-Ausbildung verantwortlich ist. Vielleicht ist es sein jahrzehntelanger Wein-Background, der ihn heute sagen lässt: „Ich verwende den Begriff auch für Bier sehr gerne.“ Allerdings brauche es Zeit, die Zusammenhänge zu erläutern. „Die Brauer hatten lange Zeit ihre Scheuklappen auf und haben sich nicht mit dem Thema beschäftigt.“ Dabei seien die Voraussetzungen, so Zepf, recht ähnlich – auch beim Bier könne Terroir definiert werden als der Einfluss von Klima, Landschaft und Boden auf die Rohstoffe und damit das fertige Produkt. Ein entscheidender Unterschied zwischen Brauer und Winzer hingegen sei, dass Brauer stark von der Wissenschaft geprägt und an die Analytik gebunden seien. „Mit analytischen Werten lässt sich der Begriff Terroir aber schwierig fassen.“ Ein weiterer, wesentlicher Unterschied zwischen Wein und Bier ist zudem, dass wir es beim Bier statt mit nur einer Pflanze mit gleich mehreren Rohstoffen zu tun haben, die je ihren eigenen Ursprung, ihr eigenes Terroir, haben können. Die Spurensuche führt uns also zum Wasser, zum Malz, zum Hopfen und zur Hefe.
Wasser – Standard sticht
Das eingangs erwähnte Pilsner Beispiel ist bei weitem nicht der einzige Fall, bei dem das Wasser den Charakter des Bieres entscheidend geprägt hat. Die Biergeschichte ist voller historisch wichtiger Brauwässer, die einen bestimmten regionalen Bierstil geprägt haben. Und auch heute lässt sich die Lage vieler traditioneller Brauereien mit der Nähe zu entsprechenden Wasserquellen erklären. Das britische Burton upon Trent etwa machte sich im beginnenden 19. Jahrhundert einen Namen für seine hellen, hopfenbetonten Pale Ales. Das Wasser mit einem hohen Anteil von Calciumsulfat betont vor allem die Bitterkeit des Hopfens. Die Zusammensetzung des karbonatreichen Münchner Wassers wiederum war bestens geeignet, um schwach gehopfte, dunkle, malzbetonte Biere zu brauen. So entwickelte sich das eigentlich typische Münchner Bier, das Münchner Dunkel. Und die frühere Bierhauptstadt Deutschlands, Dortmund, zeichnet sich durch sehr hartes, Calciumsulfat-haltiges Wasser aus, das es den Brauern erschwerte, ein Bier nach Pilsner Brauart zu brauen. Als Alternative wurde der Hopfenanteil verringert, der Malz-Charakter erhöht und das Ganze für eine längere Haltbarkeit etwas stärker eingebraut. Das so entstandene Dortmunder Export war bis in die 1970er das erfolgreichste Bier in Deutschland.

Der Terroirfaktor beim Brauwasser ist heute allerdings nahezu eliminiert. Dank moderner Wasseroptimierung lässt sich längst jedes lokale Wasser den entsprechenden Wünschen gemäß anpassen. Meist streben die Brauereien ein Wasser ähnlich dem in Pilsen an, mit möglichst geringer Restalkalität, niedriger Karbonathärte und geringer Gesamthärte. Der Bestseller im eigenen Portfolio gibt hier den Takt vor – und das ist in den allermeisten Fällen weiterhin das Pils.
Das sagen die Sommeliers

Daniel Raptis,Etz Nürnberg

Alexandra Rehberger, Schlosshotel Hohenstein

Sabrina Berger, Gabelspiel, München
Auch wenn sich diese Entwicklung aus Brauereiperspektive erklären lässt, so hat sie die Bierwelt doch etwas weniger bunt und Terroir-geprägt gemacht. „Das klassische Dortmunder Export ist dem eigentlich zum Opfer gefallen“, bedauert Michael Zepf. „Heute haben wir es meist mit einem weichgespülten Exportstil zu tun.“ Helle, filtrierte Lagerbiere nach Pilsner Vorbild machen heute weit über 90 Prozent der globalen Bierproduktion aus – ein Erfolg, der auch beim Wasser zur Standardisierung geführt und den Terroir-Einfluss zurückgedrängt hat.
Malz – die Region kommt
Das Eraclea Pilsner Malz, hergestellt aus einer feinen zweizeiligen mediterranen Gerste, angebaut in der Region um Eraclea bei Venedig, zeichnet sich durch gute Verarbeitbarkeit und Ausbeuten aus und bietet eine perfekte Grundlage für schlanke, aromareiche und mediterrane Biere. Jeder Brauer kann dieses Malz bei Weyermann, dem Weltmarktführer für Spezialmalze, aus dessen Terroir-Malz-Sortiment bestellen. Noch bevor wir die Frage beantworten, wie ein Malz das sensorische Bild eines Bieres prägt, muss zunächst also eine andere beantwortet werden, und zwar jene nach der Herkunft der Gerste, des Weizens oder auch anderer Getreidesorten, die zu Malz weiterverarbeitet werden. Bier – das wird an dieser Stelle deutlich – ist ein internationales Produkt mit Zutaten, die aus nah und fern zugekauft werden können, gewissermaßen ein Schmelztiegel verschiedenster Terroirs.
Doch selbst wenn die Brauerei ausschließlich Getreide aus der näheren Umgebung bezieht, ist der genaue Einfluss auf das Endprodukt zu Teilen noch eine Blackbox. Aktuelle Untersuchungen deuten laut Michael Zepf darauf hin, dass der Boden allein keine allzu große Rolle spielt. „Das Klima wiederum hat einen extremen Einfluss auf das Malz.“ Trockenes Klima und hohe Temperaturen etwa steigern den Eiweißgehalt und senken den Stärkegehalt, beides vom Brauer unerwünscht. Weniger trockene und heiße Regionen sind demzufolge besser geeignet für den Anbau klassischer Braugerste. Das daraus gewonnene Malz mit niedrigem Eiweißgehalt und hohem Stärkeanteil ist bestens geeignet für Biere mit hohem Vergärungsgrad – ein knackig-herbes, trockenes, norddeutsches Pils zum Beispiel. Wenn die Flensburger Brauerei in ihrem Marketing die eigene Küstengerste in den Mittelpunkt rückt, die „zwischen den Meeren an der rauen Seeluft wächst“, und deren Bedeutung für den Geschmack des Pils-Bieres betont, dann ist dies wohl tatsächlich mehr als reiner Werbesprech. Auch den Hinweis auf den hohen Jod- und Salzgehalt in der Luft findet Michael Zepf legitim. Zwar fehlen noch gesicherte Erkenntnisse, wie beim Wein vermuten aber zahlreiche Fachleute einen Zusammenhang zwischen Mineralien und Geschmack.
Der Experte beobachtet und begrüßt generell eine starke Tendenz in der Bierbranche dahingehend, regionale Rohstoffe zu verwenden. „Es gibt immer mehr Vertragsanbau in Brauereien, vor ein paar Jahren noch eine absolute Ausnahme.“ Er ist sich sicher, dass diese Entwicklung angesichts steigender Energie- und Transportkosten anhalten wird. Und nicht zuletzt, weil die Regionalität mittlerweile ein wichtiger Imagefaktor ist: „Die Verwendung von regionalem Getreide ist heute ein absolutes Verkaufsargument für Brauereien.“ Und gleichzeitig eine Chance, den natürlich geprägten Charakter des Bieres stärker herauszuarbeiten.